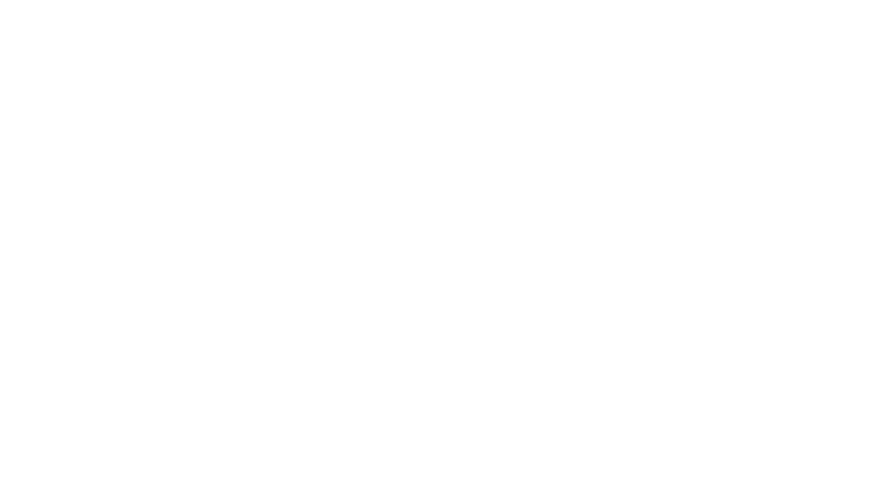Interview mit der Regisseurin
IM GESPRÄCH MIT LAURA KAEHR
Die Geschichte ist universell: Eine Frau wird Mutter und muss um ihre Karriere kämpfen. Was hat Ihr Interesse geweckt?
LK: Ich habe Giulia immer im Opernhaus Zürich tanzen sehen. In meinen Augen ist sie die erstaunlichste Künstlerin, die es dort gibt. Eines Tages erzählte sie mir, dass sie einen kleinen Jungen zur Welt gebracht hat und bald zurückkehren würde. Es war fast so, als ob diese Geschichte erzählt werden wollte. Sie hat es auch gespürt. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, wie schwierig diese Aufnahmen sein würden, wäre ich vielleicht nicht so begeistert gewesen.
Denken Sie, dass es einfacher war, weil Sie sie nicht sehr gut kannten?
LK: Viele meiner Schweizer Kolleg*innen haben schöne Filme über Familienmitglieder gemacht. Ich erinnere mich, dass ich dachte: «Meine Güte. Warum mache ich nicht einen Film über meine Mutter?» Manchmal war es schwer, denn ich bin ein intensiver Mensch. Ich wollte 7 Stunden am Stück bei Giulia zu Hause bleiben. Sie hat diesen Drang anerkannt, aber sie ist auch eine frischgebackene Mutter und hat ein eigenes Leben. Es war, als würde man eine Beziehung von Grund auf neu aufbauen, es gab Spannungen und Streitereien. Außerdem hatte sie nie einen Tag frei! Ihre Karriere dauert schon 20 Jahre – ich hatte vergessen, wie intensiv das ist. So erzählt sie uns ja auch, dass sie ihren Mann kennengelernt hat, als sie gerade verletzt war und nicht tanzen konnte.
Sie fangen auch den Moment ein, in dem Giulia darüber nachdenkt, was als Nächstes kommt. Sie ist es leid, unschuldige Mädchen zu spielen.
LK: Das ist einer der Gründe, warum ich diese Geschichte erzählen wollte. Giulia ist eine seltene Art von Künstlerin, denn sie geht wahrhaftig auf den emotionalen Aspekt ihrer Darstellungen ein. Als ich gedreht habe, gab es keine große Vielfalt an Rollen für sie: Romeo und Julia, Der Nussknacker usw. Es war sehr berührend, als sie die britische Choreografin Cathy Marston kennenlernte, die sich für Geschichten interessiert, die sich eben gerade nicht um kleine Mädchen drehen, die zu Frauen werden. Sie ist an anderen Geschichten interessiert: „Mrs. Robinson“, „Der Cellist“. Wenn die beiden sich treffen, ist das eine Offenbarung. Diese Begegnung scheint zu bedeuten, dass es Zeit für eine Revolution im Ballett ist. Ich würde mir wünschen, dass sich die Art und Weise, wie Frauenfiguren dargestellt werden, ändert. Ich verstehe, dass sie zu einer bestimmten Zeit geschrieben wurden, aber wir haben nicht so viel Fortschritt gesehen. Es ist an der Zeit, dass sich etwas ändert, und ich denke, dass die Choreografinnen die treibende Kraft sein werden.
Waren die Protagonist*innen Ihnen gegenüber nicht misstrauisch?
LK: Ich glaube, das Vertrauen kam dadurch zustande, dass sie wussten, dass ich Tänzerin bin. Ich war nicht auf die üblichen Klischees aus, ich war nicht auf Drama aus, ich habe nicht darauf geachtet, was sie essen. Ich wollte zeigen, dass es ein echter Job ist: Man hat Terminprobleme und muss sich mit seinen Kolleg*innen auseinandersetzen. Wenn man einen Dokumentarfilm dreht, ist jeder Tag anders. Man ist ständig damit beschäftigt, Konflikte zu lösen und zu kommunizieren. Man entwickelt dieses übermenschliche Einfühlungsvermögen. Einmal wollte ich Giulia in ihrem Haus zeigen, etwas Einfaches. Ich kam an und sie weinte. Du weißt nie, was dich erwartet! Aber am Ende wurde dies eine der stärksten Szenen im Film.