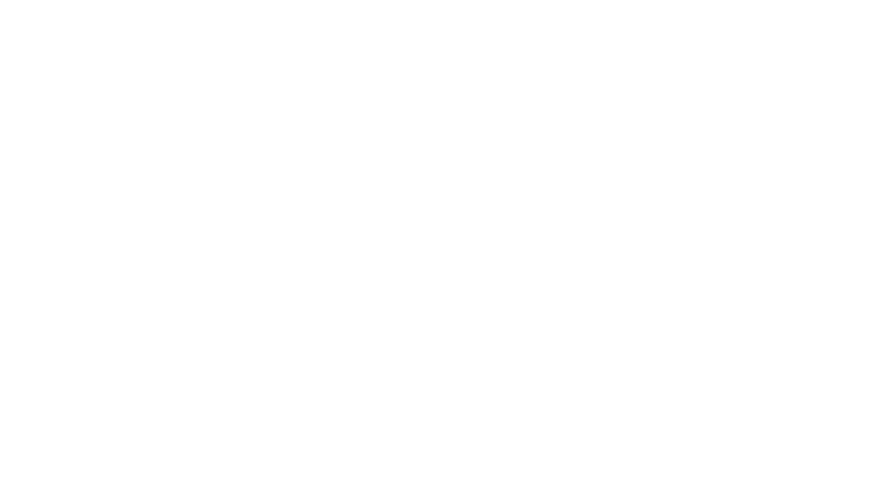Regiekommentar & Interviews
Petra Seeger über „Vatersland“
Der Initialfunke zu „Vatersland“, den man als meinen 'Lebens-Film' beschreiben könnte, entstand, als ich die Filme der Filmemacherinnen der 1970er – Helke Sander, Helma Sanders-Brahms, Jutta Brückner etc. – gesehen hatte: Denn sie machten ihr eigenes Leben zum Thema ihrer Filme. Es sollte allerdings noch Jahrzehnte dauern, bis ich mich an diese spezielle autobiografische Arbeit wagte. Der Weg zur Realisierung war lang und zog sich über 17 Jahre und viele Hindernisse hinweg – immer wieder unterbrochen von anderen Filmen, die ich drehte. Zum Glück gab es sowohl auf der Produktionsseite wie auch auf der Ebene der dramaturgischen Zusammenarbeit treue Partner*innen für „Vatersland“.
Mir war daran gelegen, einen Film zu drehen, der möglichst authentisch den Gefühlen, Erlebnissen und schmerzhaften Momenten meiner Kindheit Ausdruck verleiht. Es ging um nichts Geringeres, als sich wieder dorthin zurückzubegeben, sich zu erinnern, hinabzusteigen um Schätze, Verborgenes und Schmerzhaftes ans Tageslicht zu bringen und diesen vereinzelten Erinnerungen eine künstlerische Form zu geben; aus den einzelnen Fragmenten einen Fluss zu kreieren, der zur filmischen Erzählung wird.
Während des Schreibens sah ich mir zur Beförderung meiner Erinnerung die vielen Familienfotos und 16mm Filmaufnahmen von uns aus dem großen Archiv meines Vaters (eines Fotografen) an. Langsam entstand ein Zusammenspiel aus ebendiesem Material und dem Drehbuch, das ich schrieb. Ich beschloss, das Material meines Vaters im Film zu benutzen, steht es doch für die Selbstdarstellung der Kleinfamilie der 60er und gleichzeitig im Widerspruch zu all dem, was ich empfunden hatte und was die Bilder nicht zeigten.
Als ich während der Dreharbeiten wieder in der nachgebauten engen Dachwohnung meiner Kindheit stand, war mir bisweilen bang vor den Geistern, die ich rief... Beglückt aber war ich von meiner „neuen“ Familie: Mutter, Vater, Bruder und meiner kleinen Marie, meinem alter ego als Kind. Mit dem Schauspieler Bernhard Schütz – der meinen Vater verkörpert – an den Nuancen der Missachtung der kleinen Marie zu arbeiten oder seine Einfälle aufzugreifen, die besser als das Vater-Original waren... Oder mit der Schauspielerin Margarita Broich Perücken auszuprobieren, um sie meiner Mutter äußerlich anzupassen. Oder auch mich selbst in den kleinen Darstellerinnen wiederzufinden… All dies war kreativ und befreiend. Ich war von einer neuen Familie und von einem Filmteam umgeben, mit denen ich an der Umsetzung und am Ausdruck all dessen arbeiten konnte, was in meiner Kindheit nicht zum Zuge kam.
Marie erlebt mit 10 Jahren ihr persönliches Trauma, den frühen Tod der Mutter, in der historisch spezifischen Situation Nachkriegsdeutschlands. Die Bewältigung dieses familiären Schicksals ist im Film eng an die Zeitgeschichte gebunden. Wie soll eine gelungene persönliche und familiäre Trauerarbeit eines Vaters funktionieren, der zu einer Generation von Vätern gehört, die ‚unfähig war, zu trauern’ über die eigene Schuld und die eigenen Verluste? Wie sieht ein Alltag für die kleine Marie aus, ohne weiblichen Einfluss, geprägt vom Vater, der aus Krieg und Gefangenschaft heimkehrt, sich im deutschen Wirtschaftswunder eingerichtet hat und als Mann mit strikter Rollenverteilung groß geworden ist? Marie muss überleben in diesem Vatersland.
Der feministische Blick auf die Entwicklungsgeschichte von Marie, die in einer Familie aufwächst, in der Umgang mit Bildern und Film vom Vater an den Sohn weitergeben wird und die Frauen sich nur als Objekte in den männlichen Bildern wiederfinden: Marie gelingt es, diesen Kreislauf zu durchbrechen! Sie wird vom Objekt zum Subjekt ihrer Familiengeschichte. Sie dreht die Kamera um, steht hinter der Kamera und erzeugt die Vergangenheit neu, aus ihrem Blickwinkel. Sie hat die Regie über ihr eigenes Leben übernommen.
„Vatersland“ ist für mich auch ein Beitrag zur Debatte über die Stellung von Frauen im Filmgeschäft und der Frage, warum Frauen, trotz scheinbar gleichen Ausbildungschancen, in führenden künstlerischen Positionen so unterrepräsentiert sind. Ich denke, dass ein genaueres Hinschauen auf die Sozialisierung der jeweiligen Generationen von Frauen die feineren Gründe für die bestehende Ungleichheit beschreibt.
So subjektiv und auch persönlich wie die Geschichte von „Vatersland“ verortet ist, nicht zuletzt durch den Einsatz des dokumentarischen Materials, so universell sind die Themen, die der Film behandelt: Leben und Tod, Verlust und Trauer, familiäre Strukturen und Überwindung von Traumata, künstlerische Entwicklung sowie Vater und Mutter, die prägenden Portalsfiguren unseres Lebens.
Interviews der Regisseurin Petra Seeger
Westfalen-Blatt, 17. März 2022
RBB 12 Uhr Mittags mit Knut Elstermann, 12. März 2022
Deutschlandfunk Corso, 9. März 2022
Deutschlandfunk Kultur, 8. März 2022